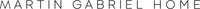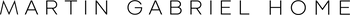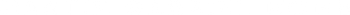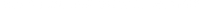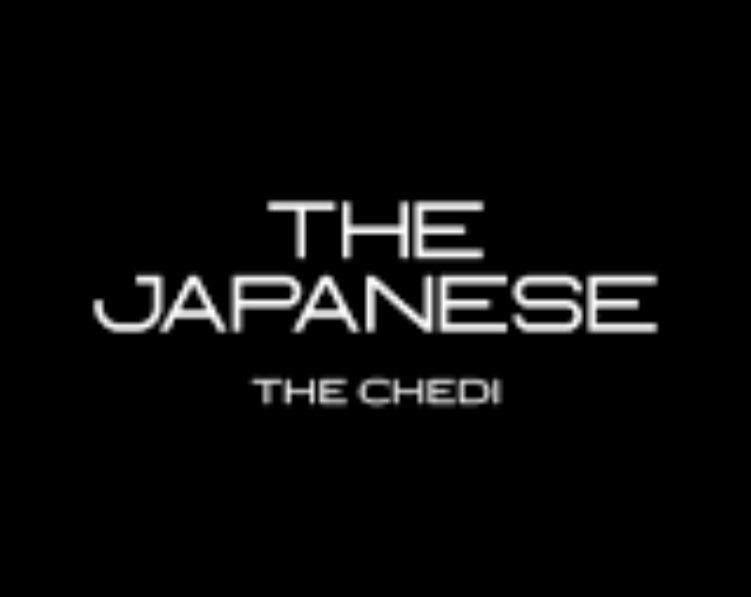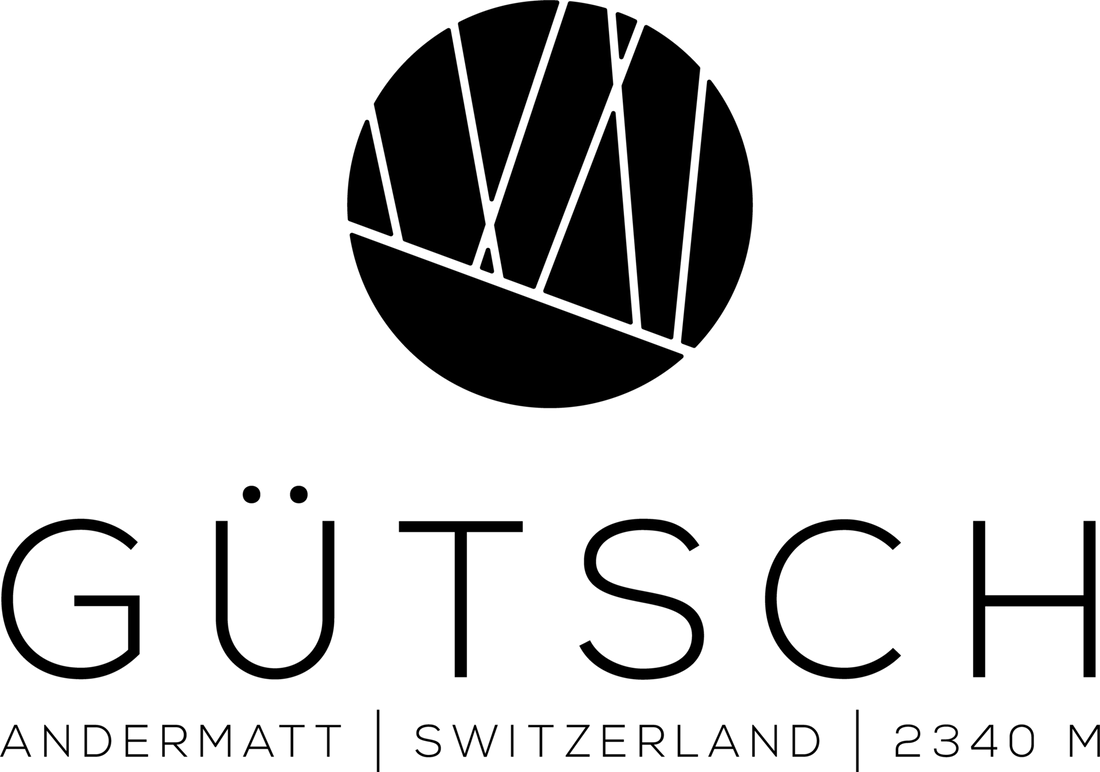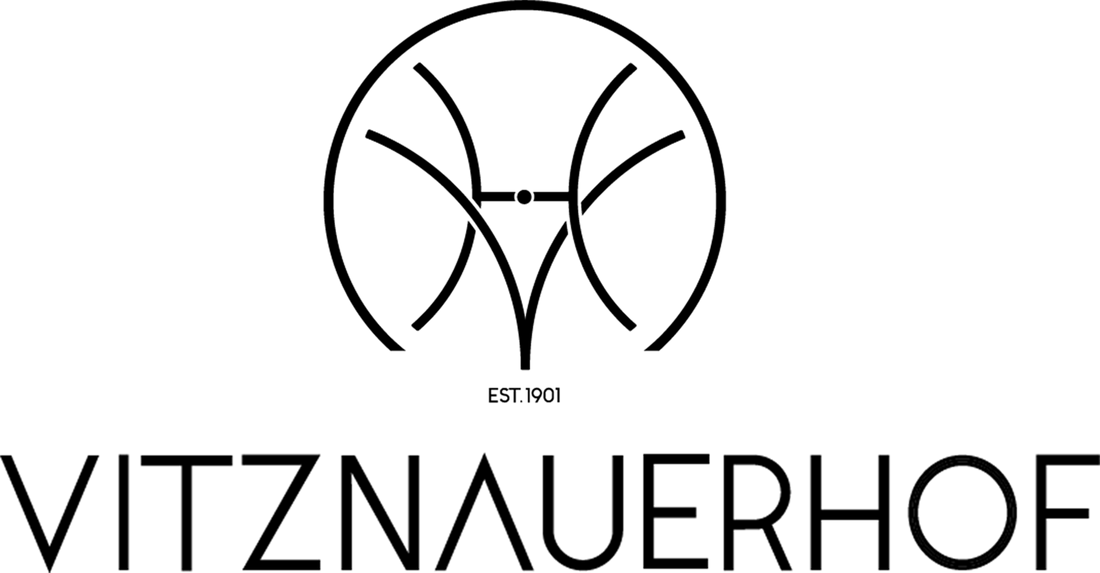Wer Martin Gabriel zum ersten Mal trifft, merkt schnell: Hier arbeitet jemand, der Wohnräume wie Projekte in Kunst, Technik und Alltagslogik denkt. Kein überflüssiges Spektakel, kein modischer Overkill. Stattdessen präzise Planung, ehrliches Material und Lösungen, die Jahre überdauern. Viele seiner Projekte spielen in der Schweiz, zwischen alpinem Gelände, dichten Stadtquartieren und Uferlagen an See- oder Flussläufen. Genau dort, wo Baukultur und Lebensqualität gern miteinander ringen.
Ein Profil zwischen Baukultur und Produktdenken
Martin Gabriel ist kein Architekt alter Schule und auch kein reiner Innenausstatter. Er kombiniert Planungsdisziplinen, handwerkliches Gespür und digitale Tools. Jede Wohnung, jedes Haus wird wie ein Produkt mit klarem Zielbild entwickelt: Was soll der Raum können, wie soll er sich anfühlen, wie pflegeleicht und wie energieeffizient soll er sein?
- Er arbeitet mit Layouts, Proportionen und Lichtführung, bevor das erste Material ausgewählt wird.
- Er kalkuliert Lebenszykluskosten statt nur Anschaffungspreisen.
- Er modelliert in 3D, simuliert Tageslicht und Heizlast, prüft Varianten mit realen Daten.
Klingt nüchtern. Wird im Ergebnis aber erstaunlich poetisch.
Die Schweiz als Bühne: Regeln, Qualität, Präzision
Schweizer Bauprojekte folgen hohen Standards. Das klingt nach Bürokratie, vereinfacht aber vieles, wenn man es richtig angeht.
- SIA-Normen: Sie bestimmen von Flächendefinitionen bis zu Toleranzen und sind der rote Faden durch Statik, Haustechnik und Ausführung.
- Minergie und GEAK: Energiestandards und Gebäudeausweise, die Planungsentscheidungen greifbar machen.
- Baubewilligung: Je nach Kanton variieren Verfahren, Fristen und Mitwirkung der Nachbarn. Gute Dossiers sparen Zeit und Nerven.
Gabriel nutzt diese Struktur als Chance. Wer früh sauber dokumentiert, gewinnt. Wer Materialien und Details erklärt, gewinnt doppelt: Auftraggeber erhalten Klarheit, Behörden eine solide Basis.
Gestaltungsprinzipien: Ruhe, Struktur, Überraschung
Räume, die man gern bewohnt, haben Ordnung. Nicht steif, sondern selbstverständlich. Drei Prinzipien leiten viele seiner Entwürfe:
-
Reduktion ins Funktionale
Jedes Element braucht eine Aufgabe. Schiebetüren, die Flächen verbinden. Einbauschränke, die Installation und Stauraum integrieren. Möbel, die mit Grundrissachsen spielen. -
Material als Story
Eiche, Esche, Lärche. Jura-Kalk, Valser Quarzit, Sichtbeton. Alle Materialien werden in ihrer Haptik und Alterung betrachtet. Eine Küche darf Spuren bekommen. Ein Boden soll elegant patinieren. -
Licht als Architektur
Tageslicht lenkt. Leuchten setzen Akzente. Warmweiß am Abend, neutral am Arbeitsplatz. Strahlungsangenehme Flächenheizung entlastet das Raumklima. Raffstores statt Dauerblendung, diffuse Deckenreflexion statt Spot-Overkill.
Der Projektablauf, der funktioniert
Von der Idee bis zur Schlüsselübergabe folgen seine Home-Projekte einem stringenten Muster:
- Bedarf und Zielbild: Interview, Tagesabläufe, Stauraum, Technikvorlieben, Budgetband.
- Vermessung und Bestandsaufnahme: Punktwolke, Leitungen, Tragwerk, Bauphysik.
- Variantenstudie: 2 bis 4 Grundrissoptionen, Materialstimmung, Invest-Folgen.
- Vorprojekt und Kostenschätzung: SIA-Phasenlogik, TGA-Konzept, Grobterminplan.
- Baueingabe und Detailplanung: Pläne, Schnitte, Leitungsführung, Beleuchtung.
- Ausführung und Qualitätsprüfung: Mock-ups, Bemusterung, Abrechnung nach Leistungsstand.
- Übergabe und Nachjustierung: Saisonale Feineinstellung der Haustechnik, Nutzercoaching.
Das mag formal klingen. In der Praxis führt es zu weniger Kompromissen am falschen Ort.
Drei exemplarische Szenarien
Stadtsanierung in Zürich
Ein 80-Quadratmeter-Altbau im Kreis 4, Deckenhöhe 3,10 Meter. Ziel: Offenheit ohne Loftspektakel. Lösung: Zwei raumhohe Schiebetafeln verbinden Küche und Wohnraum bei Bedarf, schlucken Geräusche, lassen aber die Proportionen des Bestands. Ein multifunktionales Band aus Holz fasst Küchengeräte, Garderobe und Hauswirtschaftsschrank zusammen. Die Haustechnik wird in einen Akustikrahmen integriert.
Ergebnis: 30 Prozent mehr nutzbare Fläche, spürbar bessere Luftqualität, GEAK A für die Wohnung.
Reihenhaus am Genfersee
Eine Familie wünscht ruhige Schlafzimmer und einen lebendigen Erdgeschossbereich. Gabriel teilt die Zonen über akustisch wirksame Oberflächen und die Lichtplanung. Ein fugenarmer Natursteinboden zieht sich vom Eingang in die Küche, darüber schwebt eine leichte Lamellen-Decke, die Licht streut und Leitungen verbirgt. Smarte Steuerung ja, aber ohne Technikzirkus: Szenen sind begrenzt auf Alltagssituationen.
Nachteil erkannt und gelöst: WLAN-Abdeckung und KNX-Funktionen kollidierten anfangs. Ein Kabel-Backbone und saubere VLAN-Struktur brachten Stabilität.
Ferienhaus im Prättigau
Holzbau mit klarer Geometrie. Außen Lärche, innen Esche. Ein zentrales Ofenmodul als Wärmespeicher, flankiert von einer kleinen Wärmepumpe und PV-Anlage. Große Verglasungen nach Süden, beschattet, mit tiefer Laibung. Innen kein Chalet-Kitsch, sondern textile Wärme und handwerkliche Details. Alles lässt sich im Winter energiesparend fahren, im Sommer natürlich kühlen.
Materialkultur, die bleibt
Nicht jedes Material hält, was Marketing verspricht. Gabriel gruppiert in drei Kategorien:
- Primär: Massivholz, Naturstein, Kalkputz, Ziegel, Sichtbeton in hoher Güte.
- Sekundär: Holzwerkstoffe mit emissionsarmer Verklebung, Terrazzo, Keramik im Großformat.
- Tertiär: Verbundwerkstoffe, die punktuell Sinn ergeben, wenn sie robust und wartbar sind.
Vorteile der Primärmaterialien: Reparierbarkeit, Alterungsfähigkeit, zeitlose Optik. Das führt zu geringerer Flächenfluktuation, weil man nicht alle fünf Jahre neu denkt. Wirtschaftlich wie ökologisch ein Gewinn.
Technik mit Augenmaß
Smart Home ist kein Selbstzweck. Maßgeblich ist der Nutzen. Gabrels Faustregeln:
- Licht: Szenen für Essen, Arbeiten, Abend. Präsenz in Nebenräumen, sonst Handbedienung. DALI oder Casambi für Flexibilität.
- Klima: Hybrid aus Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, guter Gebäudehülle. Fensterkontakte statt Dauerklimatisierung.
- Sicherheit: Kontaktmelder an Zugängen, Kameras nur dort, wo wirklich sinnvoll. Offline-fähige Systeme bevorzugt.
- Daten: Feste Netzwerkkabel in Arbeits- und Medienzonen. WLAN für Mobilgeräte, aber nicht als Backbone missbrauchen.
- Server: Klein, leise, zuverlässig. Open-Source, wo möglich, damit der Nutzer unabhängig bleibt.
Er sagt gern: Technik soll sich beruhigen, nicht dauernd Aufmerksamkeit verlangen.
Kosten klar strukturieren
Transparenz beginnt mit dem Budget. Gabriel teilt Budgetpositionen in drei große Blöcke:
- Bausubstanz und Hülle
- Technik und Infrastruktur
- Ausbau und Einrichtung
Beispielhafte Spannen für die Schweiz, exkl. Grundstück:
- Sanierung Wohnung, 70 bis 120 Quadratmeter: 1 200 bis 2 600 CHF pro Quadratmeter
- Umbau Einfamilienhaus: 1 800 bis 3 200 CHF pro Quadratmeter
- Neubau in Holz: 2 800 bis 4 800 CHF pro Quadratmeter
Diese Spannen hängen stark von Lage, Statik, Ausbaustandard und Termindruck ab. Mindestpuffer von 10 bis 15 Prozent im Budget sind realistischer als jede Schönrechnung.
Tabelle: Projektarten im Vergleich
| Projekttyp | Fläche | Budgetrahmen CHF/m² | Dauer Planung | Dauer Bau | Energiestandard | CO2-Aspekt grob* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungs-Sanierung Stadt | 70–120 m² | 1 200–2 600 | 6–12 Wochen | 8–16 Wochen | GEAK B bis A | mittel, stark nutzungsabhängig |
| EFH-Umbau Agglomeration | 120–180 m² | 1 800–3 200 | 8–14 Wochen | 12–24 Wochen | Minergie-Modernisierung | mittel, Verbesserung durch Hülle |
| Holz-Neubau Land | 150–220 m² | 2 800–4 800 | 12–20 Wochen | 6–9 Monate | Minergie-P | niedrig bis mittel, je nach PV |
| Chalet-Revitalisierung | 90–160 m² | 2 000–3 800 | 10–16 Wochen | 4–8 Monate | GEAK C bis A | mittel, Transport dominierend |
*Schätzung über Materialwahl und Energiequelle, kein zertifiziertes LCA.
Behutsam sanieren statt radikal entkernen
Viele Altbauten tragen Qualitäten, die man nicht replizieren kann: Proportionen, Fensterteilungen, Treppendetails. Gabriel arbeitet nach dem Prinzip der minimalen Eingriffe mit maximalem Effekt:
- Installationen neu ordnen, nicht überall.
- Tragende Eingriffe nur, wenn sie funktional entscheidend sind.
- Oberflächen mit Substanz erhalten und gezielt ergänzen.
Damit bleiben Seele und Wert. Gleichzeitig verbessert sich die Energieeffizienz spürbar.
Nachhaltigkeit ohne erhobenen Zeigefinger
Ökologie ist für Gabriel kein Label, sondern Kalkül über den Lebenszyklus. Drei Hebel wirken sofort:
- Weniger Material, dafür besseres Material.
- Sauber geplante Haustechnik, die leistet, was gebraucht wird.
- Wartung und Reparatur sind mitgedacht.
Was oft vergessen wird: Nutzerverhalten. Räume, die intuitive Bedienlogik haben, werden energiesparender genutzt. Ein klarer Schalterplan bewirkt mehr als die zehnte App.
Zusammenarbeit mit Handwerk und Industrie
Gute Projekte stehen und fallen mit Menschen vor Ort. Gabriel hält die Gewerke früh am Tisch:
- Schreinerei: Prototypen, Kanten, Fügungen, Oberflächenmuster.
- Elektro und TGA: Leitungstrassen, Wartungszugänge, sichere Reserven.
- Malerei und Putz: Musterflächen, Farbechtheit, Reinigungsproben.
- Natursteinwerk: Kantenbearbeitung, Tragbild, Fugenbild.
Transparenz in den Ausschreibungen schafft Vertrauen. Zahlung nach Meilensteinen, Qualitätskontrollen mit Checklisten, schnelle Klärung bei Abweichungen. Kein Mikromanagement, aber klare Verantwortungen.
Lichtplanung als unterschätzter Game Changer
Viele Wohnräume sind blendend hell und trotzdem dunkel. Wie geht das zusammen? Falsche Leuchten, falsche Höhen, unklare Aufgaben. Gabrels Ansatz:
- 300 bis 500 Lux für Arbeit, 100 bis 200 Lux für Entspannung.
- Indirekte Deckenaufhellung statt Spots über allen Flächen.
- Warmweiß 2700 bis 3000 Kelvin in Wohnbereichen, 3500 bis 4000 Kelvin für konzentrierte Zonen.
- Mehrschichtige Schaltung: Basis, Akzent, Aufgabe.
Das Ergebnis wirkt still und selbstverständlich. Genau darum erinnert man sich daran.
Akustik: Ruhe ist Luxus
Nicht nur im Mehrfamilienhaus ist Schall das Thema. Flankenübertragung, hallige Flure, offene Küchen mit klappernden Geräuschen. Lösungen:
- Textile Flächen, Akustikpaneele aus Holzfasern, gezielte Absorber.
- Möbel mit akustisch wirksamen Rückwänden.
- Schiebetafeln mit Verbundglas und verdeckten Dichtungen.
Wirkung: Geselligkeit bleibt, Anstrengung sinkt. Gespräche sind klarer, Musik klingt besser, Kinderlärm verliert Spitze.
Digitale Planung, analoge Ausführung
BIM-Modelle helfen bei Kollisionen und Mengen. Renderings klären Stimmungen. Doch die letzte Entscheidung fällt meist am Mock-up. Eine Ecke mit den echten Materialien, eine Lichtszene, ein Griff, der tatsächlich in der Hand liegt. Diese Muster sparen teure Überraschungen auf der Baustelle.
Häufige Fallstricke und wie sie Gabriel vermeidet
- Zu knapper Terminplan: Lieferzeiten, Trocknungszeiten, Genehmigungen. Besser echt als optimistisch.
- Materialwahl nach Bild, nicht nach Probefläche: Haptik, Pflege, Schadensbild im Alltag testen.
- Technik ohne Netzwerkkonzept: Switches, VLANs, PoE-Strategie, Backup-Strom.
- Budget ohne Reserven: Mindestens 10 Prozent Puffer.
- Kein Wartungsplan: Filterwechsel, App-Updates, Dichtungscheck, Abdichtungen.
Ein Blick in die Werkstatt: seine bevorzugte Materialpalette
- Holz: Esche für helle Ruhe, Eiche für Tiefe, Lärche für Außen.
- Mineralisch: Jura-Kalk warm, Valser Quarzit robust, Terrazzo fugenarm.
- Metall: Eloxiertes Aluminium für Details, Edelstahl gebürstet in Nasszonen.
- Oberflächen: Geöltes Holz statt dick lackiert, Kalkfarbe statt Plastiklook.
Diese Palette ergibt keine Monotonie, sondern einen ruhigen Grundklang, auf dem Individualität plötzlich sichtbar wird.
Raumökonomie in kleinen Wohnungen
Kleine Flächen lassen sich groß denken:
- Wandtiefe nutzen: Schrank, Technik, Nischen.
- Schiebelösungen statt Aufschlagtüren.
- Mehrzweckmöbel, aber nur dort, wo sie wirklich täglich genutzt werden.
- Spiegelungen und helle Deckenflächen statt grellem Licht.
Gabriel plant oft ein einziges multifunktionales Band, das Küche, Stauraum und Medien bündelt. Der Rest bleibt frei und beweglich.
Recht und Nachbarschaft
Gerade bei Dachausbauten oder Fassadenänderungen sind Nachbarn früh mitzunehmen. Visualisierungen, Schattenstudien, klare technische Maßnahmen gegen Lärm und Einblicke schaffen Akzeptanz. Eine saubere Dokumentation mit SIA-Referenzen und Brandschutzkonzepten macht Verfahren schneller.
Pflegeleicht ist kein Stilbruch
Nichts gegen spektakuläre Steinarten. Aber wer lange Freude will, sollte Pflege realistisch planen. Im Zweifel gewinnt die robuste Option:
- Seife und Öl statt Spezialchemie.
- Abnehmbare Bezüge statt Wegwerfpolster.
- Reparierbare Beschläge und quietschfreie Laufschienen.
Schönheit, die Nachsicht hat, hält länger.
Drei kurze Projektnotizen
- Berner Altbau: Kalkputz statt Gipskarton im Bad. Mehr Feuchtepuffer, angenehmer Klang, weniger Fliesenfugen.
- Luzerner Dachstudio: Gaube minimal erweitert, dafür Lichtlenkung und helle Decke. Gefühlter Flächengewinn ohne Großumbau.
- Basler Reihenhaus: Keller als Technik- und Waschküche optimiert, darüber akustisch entkoppelte Küche. Spürbar leiser.
Warum Auftraggeber wiederkommen
Nicht wegen eines Signature Looks. Sondern weil die Projekte aufgeräumt wirken, weil Entscheidungen nachvollziehbar sind, weil Mängelquoten niedrig bleiben, weil die Räume im Alltag funktionieren. Und weil Detailfragen nicht in E-Mails verschwinden, sondern gelöst werden.
Checkliste für einen guten Start
- Ziele festhalten: Funktionen, Stimmungen, Budgetband mit Puffer.
- Bestand scannen: Leitungen, Tragwerk, Feuchte, Schall.
- Varianten zulassen, aber zeitlich begrenzen.
- Mock-ups einplanen und Entscheidungen dokumentieren.
- Netzwerkkonzept vor Elektroplanung.
- Wartungs- und Reinigungsplan schreiben, bevor bestellt wird.
Nächste Schritte für Interessierte
Wer ein Projekt in der Schweiz plant, sollte früh die Rahmenbedingungen klären. Welche Bewilligungen sind nötig, welche Normen gelten, wie sieht der Zeitkorridor aus. Ein erstes Gespräch mit klaren Fragen hilft, die Größe des Vorhabens einzuschätzen:
- Was muss zwingend neu, was darf bleiben?
- Welche Aufgaben übernimmt die Technik, welche die Architektur?
- Wie hoch ist der realistische Puffer in Zeit und Geld?
- Welche Materialien sollen patinieren dürfen, welche nicht?
So entsteht aus einer Idee ein Plan, aus einem Plan ein Raum, in dem man sich jeden Tag gern aufhält.