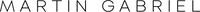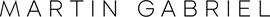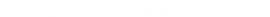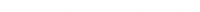Warum Outdoor-Teppiche? Die Story hinter meiner Kollektion
Die Idee, Outdoor-Teppiche zu entwickeln, ist nicht spontan entstanden. Sie begleitet mich seit acht bis zehn Jahren – also seit dem Moment, als internationale Marken wie B&B Italia, Cassina, Minotti oder Flexform begannen, ihre ersten Outdoor-Kollektionen vorzustellen.Und ich rede bewusst von diesen Brands weil sie zu den Big playern gehören und immer fest im Indoor Bereich gearbeitet haben. Und nach und nach ploppte jedes einzelne Unternehmen von ihnen auf und hatte plötzlich im Sortiment Outdoor Möbel, also wurde das Defizit und Potential auch dort erkannt.
Ich habe Outdoor-Möbel schon früh geliebt. Und ich habe schnell gesehen:
Wenn Möbel nach draußen wandern, folgt der Teppich automatisch.
Aber der Markt war noch nicht so weit.

Der Wandel: Leben findet immer stärker draußen statt
Schon damals war erkennbar, dass sich unser Klima verändert und mediterraner wird. Terrassen, Balkone und Gärten wurden mehr und mehr zu Wohnräumen, die mit dem Innenraum verschmelzen. Materialien wurden langlebiger, Texturen weicher, Farben eleganter.
Für mich war klar:
Ein Outdoor-Teppich ist nicht Accessoire – er ist die Basis.
Der Raum entsteht durch ihn. Innen wie außen.
Doch die Branche behandelte Outdoor-Teppiche wie ein Nebenprodukt.
Kunden mussten sich vorsichtig herantasten – und der Markt war voller billiger Ware, die teuer verkauft wurde.
Ich wusste: Das geht besser. Viel besser.
Qualität zuerst – und warum Handmade unverzichtbar ist
Ein Outdoor-Teppich muss viel leisten:
Wetter, UV, Temperaturwechsel, Schmutz, Feuchtigkeit, Nutzung.
Und trotzdem soll er:
-
weich sein
-
hochwertig wirken
-
schön altern
-
im Design überzeugen
Maschinenware konnte das nur bedingt.

Handgewebte Teppiche aber schon.
Sie sind angenehmer in der Haptik, weicher im Griff, schöner in der Optik – und sie transportieren Qualität, die man sieht und spürt.
Doch die eigentliche Herausforderung war nicht die Produktion, sondern die Suche nach einer Manufaktur, die:
-
zuverlässig liefert
-
internationale Qualität versteht
-
sauber verpackt
-
konstant nachproduziert
-
termintreu bleibt
Diese Suche hat Jahre gedauert.
Ich habe viele Firmen besucht, getestet, aussortiert – bis ich bei dem Partner gelandet bin, der in allen Punkten meinen Maßstab erfüllt.
Warum ich als einziger das Risiko eingegangen bin: Lagerbestand
Ein großes Problem im Markt:
Alle großen Marken bieten Outdoor-Teppiche nur auf Anfrage. Muster ja – Lieferung in 8–12 Wochen.
Für Kunden und Retailer ist das schwierig.
Menschen wollen sehen, fühlen, kaufen – jetzt.

Ich bin daher bewusst ein Risiko eingegangen:
-
ich habe jedes Design in Mengen produzieren lassen,
-
in klar definierten Standardgrößen: 160×240, 200×300, 300×400 cm,
-
und ein großes Lager aufgebaut.
Das war notwendig, denn um überhaupt mit mir zu arbeiten, verlangte die Manufaktur eine Mindestproduktion pro Design. Nur so konnte ich die Qualität sichern – und gleichzeitig sofort lieferbare Outdoor-Teppiche anbieten.
Heute ist genau das einer meiner größten Vorteile.
Allwettertauglich: getestet im Tessin
Ich habe meine Teppiche selbst unter realen Bedingungen getestet – ein Jahr lang im Tessin.
Ergebnis:
-
die Teppiche halten problemlos durch
-
Feuchtigkeit kein Problem
-
Farbe und Struktur bleiben stabil
-
Reinigung ist einfach
-
Pflege minimal und logisch (wie bei jedem Outdoor-Produkt)
Im Winter rollt man ihn zusammen und lagert ihn trocken – mehr braucht es nicht.

Warum ich davon überzeugt bin
Ich liebe Outdoor-Living.
Ich liebe Materialien.
Ich liebe Qualität.
Und ich bin überzeugt:
Ein Outdoor-Teppich verändert die Lebensqualität eines Außenraums sofort.
Barfuß darüber zu gehen – das ist der Unterschied.
Ich habe viel Geld, Zeit und Herzblut investiert. Ich habe getestet, verworfen, verbessert. Ich habe gelernt, welche Strukturen funktionieren, welche Fasern sich bewähren, wie Transport, Lagerung und Nachlieferung effizient bleiben.
Heute weiß ich:
Es hat sich gelohnt.
Und diese Kollektion ist nur der Anfang.