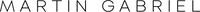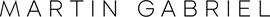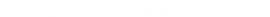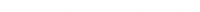HILTON LAC DE CÔME









HILTON LAC DE CÔME
Je suis ravi de vous présenter une sélection de photos d'un récent projet au Hilton Lake Como, présentant une sélection de mes collections intérieures et extérieures. Ces espaces sont le fruit de mon travail et je suis très fier de les voir prendre vie. Pour les découvrir de plus près, n'hésitez pas à consulter la catégorie « Images animées », où vous pourrez visionner des séquences vidéo de ces espaces époustouflants. Je suis profondément passionné par mon travail et je suis ravi de savoir que ces créations apportent du bonheur. Merci de l'intérêt que vous portez à mes créations et j'espère que ces images vous inspireront pour vous lancer dans votre propre aventure créative !